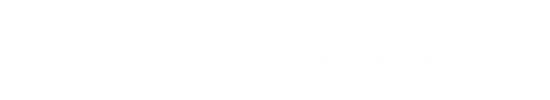Zur Vermeidung von Missverständnissen:
in dem mir zur Stellungnahme vorgelegten Entwurf lautet § 829a ZPO wie folgt:
"§ 829a
Elektronischer Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses
(1) Soweit bei einem Antrag auf Pfändung (§ 829), Pfändung und Überweisung (§§ 829, 835) oder Überweisung (§ 835) einer Geldforderung die Übergabe oder Vorlage
1. der Ausfertigung des Vollstreckungstitels,
2. der Vollstreckungsklausel oder
3. weiterer Urkunden zum Nachweis der Vollstreckungsvoraussetzungen
erforderlich ist, genügt es bei einem elektronischen Antrag, die in Papierform vorliegenden Schriftstücke in die elektronische Form zu übertragen und dem Gericht die elektronischen Dokumente zu übermitteln. § 130d Satz 1 ist auf die in Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Dokumente nicht anzuwenden.
(2) Bestehen die Dokumente nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 nicht mehr oder treten Änderungen an ihnen auf, nachdem die elektronischen Dokumente über-mittelt worden sind,
1. ist das Gericht hierüber unverzüglich zu informieren;
2. sind die geänderten Schriftstücke, sofern vorhanden, in die elektronische Form zu übertragen und dem Gericht diese elektronischen Dokumente zu übermitteln;
3. darf das Gericht auf die ursprünglich übermittelten elektronischen Dokumente nicht mehr zugreifen.
(3) Der Antragsteller hat dem Gericht in Textform zu versichern, dass ihm diejenigen der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Dokumente, die er als elektronische Dokumente übermittelt hat, vorliegen und sie jeweils bildlich und inhaltlich mit den übermittelten Dokumenten übereinstimmen.
(4) Kann das Gericht anhand der übermittelten Dokumente nicht zweifelsfrei fest-stellen, dass die Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung vorliegen, teilt es dies dem Antragsteller mit und fordert die aus seiner Sicht erforderlichen Dokumente an.“
Ich lese daraus nicht, dass uns hier jegliche Prüfungspflichten abgesprochen worden sind.
Ich sehe hier nur den Unterschied, dass es elektronisch eingereicht werden darf (nicht muss!), wenn die in Papier vorliegenden Dokumente in die elektronische Form überführt worden sind.
Dazu erhalte ich die Versicherung des Antragstellers nach Absatz 3.
Selbstverständlich habe ich diese Unterlagen sorgfältig zu prüfen und kann im Zweifel das Original anfordern.
Für mich ist das eine große Vereinfachung, weil ich Anträge direkt (fertig) bearbeiten kann und nicht einen Tag auf den Zutrag der Papiertitel warten muss.