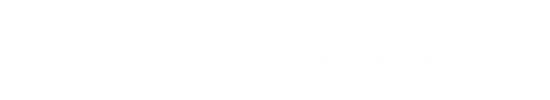....3. D. war minderjährig. Eine familiengerichtliche Genehmigung wurde nicht erteilt. Nunmehr ist D volljährig und genehmigt alles nochmal. Soweit so gut....
Dann müsste der Vertretungsmangel ja geheilt sein.
Der Nießbrauch kann als Eigentümernießbrauch vor Vollzug des Eigentumswechsels eingetragen werden. Dass das Grundstück insgesamt zu belasten ist, ergibt sich mE aus der Formulierung: „der Erschienene A wendet der Erschienenen B zu, und die Erschienene B behält sich auf Lebensdauer den Nießbrauch am gesamten Vertragsgegenstand vor“. Ohne die Zuwendung das A hätte sich B den Nießbrauch nur an ihrem eingebrachten ½ MEA vorbehalten können. Aus der Formulierung ergibt sich mE auch, dass vom Nießbrauch das Grundstück betroffen ist.
Allerdings kann die zur Eintragung bewilligte Rück-AV und die weitere AV schon wegen des Identitätsgebots zwischen Anspruchsschuldner und eingetragenem Eigentümer (siehe Keller/Munzig, KEHE Grundbuchrecht - Kommentar, 9. Auflage 2024, § 19 GBO RN 58; Monath, Kettenkaufverträge, RNotZ 9/2004, 359/364 ff.
https://www.dnoti.de/download/?tx_dnotionlineplusapi_download%5Bnodeid%5D=6c3c9e15-35ac-4416-a3ee-3e134aad52b7&tx_dnotionlineplusapi_download%5Bpreview%5D=1&tx_dnotionlineplusapi_download%5Bsource%5D=0&cHash=4da3ac486b72c08d90334cee071b0536
je mwN) nur von den Vertretungsberechtigten der KG zur Eintragung bewilligt werden.
Die KG existierte aber zum Zeitpunkt der Abgabe der Eintragungsbewilligung nicht. Folgt man der Ansicht des KG im Beschluss vom 04.11.2014 - 1 W 247-248/14 = BeckRS 2014, 21749, dann trifft das Handelsregister hinsichtlich der Vertretungsverhältnisse Aussagen aber erst für den Zeitpunkt der Eintragung; auf frühere Zeiträume erstrecke sich die Beweiswirkung nicht.
Hingegen lassen sich nach dem Beschluss des OLG Hamm vom 14.10.2010 - I-15 W 201/10; I-15 W 202/10,
Oberlandesgericht Hamm,
I-15 W 201 + 202/10
die Existenz und Vertretungsverhältnisse einer Kommanditgesellschaft in Gründung zum Zeitpunkt der notariellen Beurkundung eines Grundstückserwerbsvertrages durch die später erfolgte Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister nachweisen (s. Rz. 11). Die KG sei mit der Vor-KG identisch und trete mit ihrer Eintragung im Handelsregister an deren Stelle.
Wie Demharter in Grundbuchordnung, 33. Auflage 2023, § 19 RN 104 ausführt, erbringt damit die Handelsregistereintragung den Nachweis für Existenz und Vertretungsverhältnisse der Vor-KG als Auflassungsempfängerin (Zitat: OLG Hamm FGPrax 2011, 61; aM KG FGPrax 2015, 10 mablAnm Wilsch ZfIR 2015, 64 und kritischer Anm. v. Kesseler MittBayNot 2015, 505).
Kilian hält in Bauer/Schaub, Grundbuchordnung, 5. Auflage 2023, § 20 RN 136 die Frage, ob der Nachweis der Existenz/Identität und Vertretungsmacht einer vor Eintragung im Handelsregister entstandenen KG für Erklärungen, die vor Eintragung im Handelsregister abgegeben wurden, (allein) durch den Handelsregisterauszug über die später erfolgte Eintragung geführt werden kann, für umstritten und verweist dazu in Fußnote 189 auf „Pro: OLG Hamm FGPrax 2011, 61; contra: KG FGPrax 2015, 10 = MittBayNot 2015, 331 = MittBayNot 2015, 505 Ls. m. krit. Anm. Kesseler = Rpfleger 2015, 262“
Dass die seinerzeit noch im Gründungsstadium befindliche KG mit der später im HR eingetragenen identisch ist (siehe OLG Hamm aaO., Rz. 10), lässt sich aber durch die Einsicht in die HR-Unterlagen feststellen (siehe Jurksch, Einsicht in das elektronisch geführte Handelsregister durch das Grundbuchamt, Rpfleger 2014, 405).
Wie Kesseler in seiner Anmerkung zum Beschluss des KG vom 4.11.2014, 1 W 247-248/14 in der MittBayNot 6/2015, 505/506
https://www.notare.bayern.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/MittBayNot_6_2015.pdf
ausführt, können für die KG alle Gesellschafter gemeinsam handeln, gleichgültig was im Gesellschaftsvertrag vereinbart ist.
In deinem Fall haben ja alle Gesellschafter der KG die Eintragung der Rück-AV bewilligt (Zitat: „Hierzu soll eine Rückauflassungsvormerkung zugunsten des Schenkers auf Rückübertragung des in die Gesellschaft eingebrachten Grundstücks eine Vormerkung eingetragen werden. Auch hier bewilligen alle Vertragsteile“).
Allerdings würde sich mir die Frage stellen, warum es zuvor „die Schenker“ und nunmehr „zugunsten des Schenkers“ heißt. Ich vermute daher, dass nicht eine, sondern zwei Rückauflassungsvormerkungen, also je eine für jeden Schenker bezogen auf einen ½ MEA, eingetragen werden sollen (und nicht eine einzige für die Schenker zu je ½ Anteil). Dafür spricht auch, dass die weitere AV zugunsten der Schenker („Weiterhin behält sich jeder Schenker das Recht vor, durch persönliche Erklärung gegenüber der Gesellschaft die Übertragung des von ihm eingebrachten Grundbesitz-Anteils auf eine neu zu gründende KG zu verlangen“) für jeden der beiden Schenker einzutragen ist.